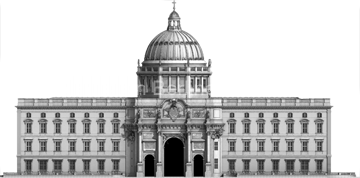22.09.2021 DIE WELT
So schaut man sich um mit wachsender Demut. Und ebenso mit wachsender Scham. Denn Saal um Saal will erwandert werden, die Ausstellung scheint kein Ende zu kennen, die schiere Menge ist fantastisch und bedrängend zugleich. Unwillkürlich will man wissen, welchem Entdeckerstolz, welcher Sammelgier sich das alles eigentlich verdankt. Und was es wohl sein mag, das die Spezies Mensch dazu treibt, große Museen und noch viel größere Depots mit Dingen anzufüllen, von denen oft unklar bleibt, wer sie aus welchen Gründen erschuf und warum sie unbedingt nach Berlin kommen mussten.
Natürlich, es war nicht die Spezies als solche, es war vor allem der Europäer, der hinauszog in die Welt und sie sich unterwarf. Er wollte reich werden, das ist bekannt. Er wollte aber auch die eigene Gattung erkunden und sammelte deshalb „Ethnographica“ und „Archaeologica“, so wie er Käfer sammelte oder Kakteen. Nicht um die Kunst ging es, sondern darum, in den Artefakten ferner Gesellschaften die eigenen Ursprünge zu entdecken. Deshalb gelangten bevorzugt jene Stücke nach Berlin, die einer unberührten, authentischen Kultur zu entstammen schienen. Und je weiter die Moderne voranschritt, je mehr Erdteilen sie die eigene Lebensweise aufzwang, desto begehrter wurden die Zeugnisse der Unverdorbenheit, weil man sich nach ebendieser sehnte. Auch davon erzählt die Ausstellung: wie die Suche nach dem Eigentlichen jede Eigentlichkeit verdarb.
Oft hat man den ethnologischen Museen vorgeworfen, sie verschwiegen die koloniale Gewaltgeschichte, der sie sich verdanken. Und es stimmt, ihr Wille zur Selbstaufklärung war meist überschaubar. Wurden die Sammelstücke redlich erworben oder ihren Besitzern abgeluchst oder geraubt? Auch die Berliner Museen wissen es in vielen Fällen bis heute nicht. Und oft lässt es sich schon deshalb nicht klären, weil es Matrosen, Soldaten, Kaufmänner waren, über die das Sammelgut nach Deutschland kam, ohne dass diese Leute wussten, wer die Dinge genau wo und zu welchen Zwecken angefertigt hatte.
Selbst für das bekannteste Ausstellungsstück der Berliner Sammlung, das Luf-Boot, kann das Museum nicht mit Gewissheit sagen, ob die Einwohner der damaligen Kolonie Deutsch-Neuguinea ihr reich ornamentiertes Boot freiwillig hergaben. Die Forschungslage sei unklar, heißt es in den begleitenden Texten. Und das stimmt und stimmt nicht. Es gibt für die Erwerbsumstände keine eindeutigen Quellen; was es aber gibt, sind Berichte über die brutale, brandschatzende Herrschaft der Deutschen. Leicht kann man sich vorstellen, in welcher Zwangslage die Insulaner waren. Hätten sie sich den Wünschen der Besatzer verweigern können? Wurde ihnen das Boot abgezwungen, ohne dass es nach Zwang aussah?
Gezeigt wird es nun in einer riesigen Halle, von einer Empore aus schaut man hinab, es wirkt dort recht einsam und bedürftig. Wie gut wäre es gewesen, hätten die Museen vor Jahren schon und mit der gebotenen Gründlichkeit nachgeforscht, was es mit ihrem zentralen Ausstellungsstück auf sich hat. Jetzt wirkt es so, als wollten die Kuratoren noch immer etwas verschleiern und die Kolonialgeschichte kleinreden. Dabei ist die Aufarbeitung in anderen Fällen längst in Gang gekommen.
Gerade ist ein kleiner Führer erschienen, der akribisch davon berichtet, wie rücksichtslos viele Sammler vorgingen, wie verächtlich sie auf jene Kulturen herabschauten, deren Artefakte sie an sich rissen – um sie dann in europäischen Museen verstauben zu lassen. 1400 Objekte kamen so einst aus der deutschen Kolonie im heutigen Namibia nach Berlin, über Jahrzehnte waren sie weggesperrt im Depot. Erst kürzlich durften sieben Forscher und Forscherinnen aus Windhuk anreisen, um sich über die ungeklärte Herkunft und Bedeutung der Dinge auszutauschen. Und um mit den Berliner Kollegen darüber zu beraten, was nun geschehen soll. In solchen Gesprächen geht es tatsächlich um das „Gelingen der Globalisierung“, wie Merkel es anmahnte, um Austausch, um Erinnerung und auch darum, einzelne Objekte zurückzugeben. Schlachten müssen dafür nicht geschlagen werden. Es ist eine tastende Arbeit, die Zeit braucht, mehr Zeit, als es die Großdebatten erlauben.
Die Sammlungen in Berlin sind zu groß, und zu groß ist auch der Überbau, der mit ihnen untermauert werden soll. Wer hier die überfällige Auseinandersetzung um Kolonialismus und Gerechtigkeit führen will, findet Belegstücke in Hülle und Fülle. Und riskiert zugleich, die Skulpturen und Schmuckstücke ein zweites Mal zu vereinnahmen, nun im Dienste des europäischen Diskurses.
Es ist ein Museum der gemischten Gefühle geworden, das macht die Stärke des neuen Humboldt Forums aus. Über weite Strecken gelingt es, die Balance zu wahren. Das Museum lässt uns die Eigenmacht der Dinge spüren, ihre Würde; zugleich bleibt die Frage nach Schuld und Verantwortung nicht außen vor. Ohnehin wird sie sich weiterhin stellen, schon deshalb, weil die Ausstellung längst nicht komplett ist. Der zweite, ebenfalls große Teil soll im nächsten Sommer aufmachen, dann werden auch die Benin-Bronzen zu sehen sein oder jedenfalls das, was von den Werken noch in Berlin sein wird. Völlig zu Recht drängt Nigeria auf Rückgabe. Endlich ist der deutsche Staat zu Gesprächen bereit.
Übrigens, auch Europäer treffen in der Ausstellung auf ihre Ahnen, auf Figuren aus Holz, von afrikanischen Künstlern in der Kolonialzeit geschnitzt. Weiß getüncht sind die Gesichter, blau die Augen, um den Mund ein verkniffener Zug. Verdutzt sehen sie uns an, diese Ahnen. Noch verdutzter schauen wir zurück.
QUELLE: DIE ZEIT, 22.09.2021
 Deutsch
Deutsch English
English Francais
Francais